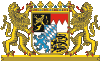Landwirtschaftsschule Schweinfurt, Abteilung Landwirtschaft
Internationaler Austausch
Landwirtschaft in Westafrika: Besuch eines Direktors aus dem Senegal
Organisiert von der Katholischen Landvolkbewegung gab es im November 2023 Besuch aus dem westafrikanischen Senegal. Abbé Etienne Ndéné NDONG, Direktor der Caritas in der Diözese Kaolack, ist auch verantwortlich für die Projekte zur Förderung der landwirtschaftlichen Bildung. Die Landwirte im Senegal haben mit ähnlichen klimatischen Veränderungen zu kämpfen wie wir in Unterfranken. Die Extreme wie Trockenheit und Starkregen nehmen zu, die Böden können dadurch weniger Wasser speichern und leiden unter Erosion.
"Wir sind beeindruckt: Die Projekte, die wir vorgestellt bekommen haben, erscheinen sehr weitsichtig und setzen immer den Fokus auf 'Hilfe zur Selbsthilfe'. Wir unterstützen das gern mit unserem Fachwissen. Bildung verringert Landflucht und hilft auch, Migration aus dem Senegal entgegenzuwirken."
Klaudia Schwarz, Behördenleiterin AELF Schweinfurt
Die Katholische Landvolkbewegung Würzburg unterstützt die Errichtung und den Betrieb des "Zentrums zur sozialen und beruflichen Integration junger Menschen durch landwirtschaftliche Ausbildung und Berufsförderung" der Caritas Kaolack. Das Angebot richtet sich an junge Männer und Frauen zwischen 18 und 35 Jahren aus dem ganzen Senegal. Es werden die beiden Zweige Pflanzenbau und Tierzucht angeboten.

"Et donc, dans la formation que nous donnons il faut dire que la cible d'abord, c'était des jeunes garçons et filles en déperdition scolaire, qui était parfois même analphabètes."
(Abbé Etienne Ndéné NDONG, Direktor der Caritas in der Diözese Kaolack)
"Und so muss man sagen, dass die Zielgruppe, in der Ausbildung, die wir geben, in erster Linie Jungen und Mädchen waren, die die Schule abgebrochen hatten, die sogar Analphabeten waren."
Vor Aufnahme in das Bildungszentrum wird jeweils geklärt, dass dem/der Bewerber/in nach der Ausbildung ein ausreichendes Stück Land vor Ort zur Verfügung steht. Bei den dazu notwendigen Verhandlungen werden die jungen Erwachsenen von dem Zentrum unterstützt. Die Produktion in dem Lehrbetrieb erfolgt mit umweltgerechten Techniken. Die Auszubildenden entwickeln mit fachlicher Begleitung ihr eigenes, für sie individuell passendes Unternehmensprojekt. Bei der Gründung ihres landwirtschaftlichen Kleinstunternehmens werden sie sodann fachlich und auch ökonomisch unterstützt.