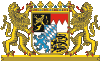Pressemitteilung vom 30.04.2020
Schwammspinner im Klimawandel
Befallsfläche ausgeweitet – jetzt auch in Buchenwäldern
Der Schwammspinner hat sich im Sommer 2019 weiter stark verbreitet. Dies gilt sowohl regional als auch hinsichtlich befallener Waldstrukturen. Über ein Drittel der Behandlungsfläche im Amtsbereich liegt in neuen Gebieten, in denen der Schwammspinner in der Vergangenheit nie waldschädliche Dichten zeigte. Gleichzeitig droht nun Kahlfraß auch in buchenreicheren Wäldern, die bisher als zu „kühl“ für den Schwammspinner angesehen wurden. Beide Entwicklungen stehen vermutlich im Zusammenhang mit den zurückliegenden heißen Jahren.
Ob der Wald gravierenden Schaden nimmt, hängt einerseits von der Stärke des Schwammspinnerfraßes ab und andererseits vom Vitalitätszustand, den Abwehrkräften der Bäume. In den Extremjahren 2015, 2018 und 2019 waren die Bäume in der Region starker Hitze und Trockenheit ausgesetzt. 2019 zeigten sich bisher so nicht gekannte Schäden und diese auch an Laubbäumen, insbesondere an Rotbuchen. Ebenso nahm bei der Eiche seit Sommer 2019 der Umfang der Schäden und damit verbunden der zwangsweise Einschlag geschädigter Bäume zu. Gerade das Zurücktrocknen und Absterben von beigemischten schattenspendenden Buchen und Hainbuchen führt zu einer weiteren Erwärmung von Eichenwäldern. Dies begünstigt den wärmeliebenden Schwammspinner und dessen weitere Ausbreitung zusätzlich.
Umfangreiche, sorgfältige Vorarbeiten
Die vor Ort erfassten Daten hat die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) in Freising ausgewertet, um präzise jene Laubwälder herauszufiltern, auf denen für das Jahr 2020 die Gefahr eines Kahlfraßes besonders hoch ist.
Information der Waldbesitzer
Berücksichtigung von besonderen Schutzgütern
Auch werden zu Waldrändern, Gewässern, Wohngebäuden und Straßen bei der Mittelausbringung per Hubschrauber entsprechende pflanzenschutzrechtliche Abstände eingehalten. In Wasserschutzgebieten findet keine Behandlung statt.
Eingesetzt wird das Pflanzenschutzmittel Mimic, welches seit Jahren auch im Obst- und Weinbau eingesetzt wird. Als sogenanntes Fraßinsektizit entfaltet Mimic seine Wirkung, sobald die Raupen des Schwammspinners beginnen, Eichenblätter zu fressen. Ziel ist es, möglichst spezifisch nur diejenigen Arten zu treffen, welche in den kommenden Wochen die Blätter der Eiche als Nahrung nutzen. Das ausgebrachte Mittel ist weder für den Menschen noch für Bienen gefährlich.
In der Öffentlichkeit wird immer wieder diskutiert, ob alternative Gegenmaßnahmen angewendet werden sollten. Jede diskutierte Maßnahme muss zwei Voraussetzungen erfüllen: sie muss wirksam und in der Praxis realisierbar sein. Die Eigelege sind nicht nur am bodennahen Stamm sondern meist unerreichbar in der Krone. Mag ein mechanisches Entfernen am Stamm noch möglich sein ist ein Pflanzenschutzmitteleinsatz in den 25 – 30 Meter über dem Boden befindlichen Kronen unumgänglich. Dabei dürfen nur in Deutschland amtlich zugelassene Pflanzenschutzmittel verwendet werden. Es geht auch nicht um einzelne Bäume sondern um hunderttausende auf mehreren tausend Hektar.
Absperrungen
Am 1. Mai findet kein Pflanzenschutzmitteleinsatz gegen den Schwammspinner statt.
Fortsetzung und Intensivierung der Begleitforschung
2020 starten zusätzlich die Arbeiten eines bundesweiten Forschungsprojektes zum künftigen Waldschutz. Mehrere Waldbesitzer im Amtsbereich haben der LWF Untersuchungsmöglichkeiten in ihren Eichenwäldern zur Verfügung gestellt.